 Hole den Becher
Hole den Becher
Ein junger Mann ging eines Tages in einen großen, tiefen Wald. Er hatte sich aufgemacht, einen alten Weisen zu suchen, von dem er gehört hatte. Er war lange Zeit gewandert, ohne ihn zu finden. Seine Sehnsucht, mit diesem Weisen zu sprechen, ihn zu fragen, wo Gott sei, diese Sehnsucht war so groß, dass er nicht innehielt und immer weiter wanderte.
Eines Tages traf er auf eine große Lichtung und spürte in sich, dass er sein Ziel nicht mehr fern war. Er wanderte geradewegs über die Lichtung hinweg und erblickte am Rande der anderen Seite ein schönes, prächtiges Haus. Er ging auf dieses Haus zu und war etwas verwirrt. Das Haus war so wunderschön und gepflegt, der Garten herum war ebenfalls eine Pracht. Alles fügte sich harmonisch ineinander. Alle Blumen, Gräser und Kräuter, die hier wuchsen, ordneten sich in Gruppen und waren einfach herrlich anzuschauen. Kein Kraut, keine Pflanze drängte sich vor oder wucherte, alles war in einer wunderbaren Ordnung, in einer wunderbaren Harmonie.
Ach, dachte er bei sich, das ist sicherlich nicht das Haus des Weisen, das ich suche. Er wird sicher in einer Höhle oder in einer alten, ärmlichen Hütte wohnen. Die Neugierde, wer wohl hier in diesem wunderschönen Haus lebte, war im Augenblick jedoch größer als das Verlangen, den alten Weisen in seiner Höhle zu finden. So ging er durch den Garten auf das Haus zu.
Es war herrlich, hier zu gehen. Wie wunderbar weich war der Boden, wie wohlig waren die Gerüche. Er betrat das Haus. Auch hier fiel ihm die wunderbare Harmonie auf. Es gab nur einen Raum. Er erinnerte ihn an einen Tempel. Doch vergeblich suchte er eine Stelle, die einem Altar glich, auf dem Opfer dargebracht werden. Er konnte sich aber des Eindruckes nicht erwehren, in einem Tempel zu sein.
In der Mitte saß, ihm mit dem Rücken zugekehrt, eine Gestalt mit langem Haar. Er schöpfte wieder Hoffnung und dachte bei sich: Das wird wohl der alte Weise sein. Da kann ich ihm gleich meine Fragen stellen. Und schon sprudelte es aus ihm heraus: „Hallo, bist Du der alte Weise? Ich hätte so gerne gewusst, wie ich zu Gott komme, wo ich ihm begegnen und wie ich IHN finden kann. Sag es mir bitte schnell. Meine Sehnsucht ist so groß.“
Die Gestalt am Boden bewegte sich nicht und sagte auch lange Zeit nichts. Dann, nach einer schier unendlich erscheinenden Zeit drehte sich der Mann um, stand dabei auf und kam auf ihn zu. Der junge Mann erschrak. Er hatte ein altes und runzeliges Gesicht erwartet. Doch dieser Mann war jung, sportlich und wunderschön. Nein, das konnte nicht der alte Weise sein, den er suchte. So bereute er schon seine Fragen, die so aus ihm herausgesprudelt waren.
Der junge Einsiedler gebot ihm mit einer einladenden Geste, am Boden Platz zu nehmen und setzte sich selbst zu seinem Besucher. Lange schaute er ihn an und fragte dann: „Ist Deine Sehnsucht wirklich so groß?“ „Ja“, sagte er, und wieder sprudelte es aus ihm heraus. Alles, was er schon unternommen hatte, seine Kasteiungen, seine Fastenzeiten, seine Gebete, seine Meditationen, seine Körperübungen, alles erzählte er. Und immer, so bedauerte er, habe es ihn nicht zu Gott geführt, sondern nur die Sehnsucht vergrößert.
Der junge Einsiedler hatte die Augen geschlossen und ihm aufmerksam zugehört. Als der junge Mann aufhörte zu sprechen, ließ der Einsiedler die Augen noch immer zu und schwieg.
Es verging eine lange Zeit. Der junge Mann befürchtete schon, der Einsiedler sei vielleicht eingeschlafen. Es verging eine noch längere Zeit, und dann dachte er sich, er müsse nun doch ausgeschlafen haben. Und wie er so seinen Gedanken nachhing, wie lang wohl ein Einsiedler zu schlafen habe, öffnete dieser die Augen und strahlte ihn an. „Gott ist Alles und Gott ist Nichts, wo willst du ihm begegnen?“ Schnell antwortete der junge Mann: „Im Alles“, denn im Nichts, das erschien ihm doch ein wenig langweilig. „Es ist ganz einfach!“ sagte der Einsiedler. „Du musst nur einen Becher voll aus dieser Quelle dort hinten trinken.“ Mit seinem Arm deutete er auf eine munter sprudelnde Quelle im Raum. „Dann wirst Du Gott begegnen!“
So einfach sollte das sein, Gott zu finden? Das glaube ich nicht! Dies waren seine ersten Gedanken. Und er bat: „Ja, wenn es so einfach ist, dann gib mir schnell einen Becher und lasse mich hingehen und davon trinken, mich dürstet danach.“ Doch der junge Einsiedler wehrte mit der Hand ab und sagte: „So leicht geht es auch nicht, man kann nicht einen beliebigen Becher nehmen und damit trinken. Man muss sich selbst ein Gefäß schaffen, man muss dafür arbeiten! Und erst, wenn dieses Gefäß schön, edel und gut ist, kann man zur Quelle gehen und damit schöpfen.“ „So sag mir, Meister, wo kann ich so ein Gefäß kaufen? Ich gehe los und hole mir gleich eines, damit ich, sobald ich zurück bin, von dieser Quelle trinken kann.“ Der Einsiedler erzählte ihm, dass es hier, wo er nun sei, keine Möglichkeit gäbe, ein solches Gefäß zu erwerben. Er müsse dazu auf der Erde geboren werden; dann ginge alles wie von selbst. Er müsse aber darauf achten, dass seine Sehnsucht, Gott zu finden, immer groß genug ist.
Der Einsiedler, den er mittlerweile als Meister benannt hatte, versicherte ihm, dass er ihn unsichtbar bei der Wanderung auf der Erde immer begleiten und hilfreich zur Seite stehen werde. Der junge Mann willigte ein. Er legte sich nieder, schloss die Augen und begann, einen wunderbaren Traum zu träumen.
Er war auf der Erde; seine Kindheit verging schnell, und seine Jugend war immer wieder durchpulst von einer großen Sehnsucht nach etwas, das er nicht kannte, das er nicht wusste. Kaum, dass er ein junger Mann war, begab er sich auf die Wanderschaft, um zu suchen. Lange schon wanderte er, bis er in einem großen Wald zu einer Anhöhe kam, in der eine Höhle war. Darin saß ein alter Mann mit einem langen grauen Bart. Den fragte er: „Du, Alter, ich suche etwas und weiß nicht was, und ich weiß auch nicht wo. Kannst du mir helfen?“ Der Alte schaute ihn an und erwiderte: „Ja, ich kann dir helfen, doch ich tu es erst, wenn du mir einen Becher geholt hast.“ Der Alte beschrieb ihm eine Hütte, die am Rande des Waldes stand. In ihr sei der Becher, den er holen sollte. Er sollte sich auch beeilen, weil er nicht Lust hätte, allzu lange zu warten. So machte sich der junge Mann noch am selben Tage auf den Weg, fand nach kurzer Zeit die Hütte und ging hinein. Doch die Hütte war leer bis auf einen Stuhl und einen Tisch. Auf dem Tisch lag ein Klumpen Ton, sonst nichts. Die Tür war hinter ihm ins Schloss gefallen, und als er versuchte, wieder hinauszugehen, stellte er fest, dass sie verschlossen war. Er versuchte es mit allen Möglichkeiten herauszukommen, aber es gelang ihm nicht. Also setzte er sich auf den Stuhl und dachte lange über das nach, was er nun erlebt hatte, und vermutete, dass er wohl in eine Falle geraten war. Aber er verwarf den Gedanken wieder, er kam sich irgendwie nicht eingesperrt vor, auch nicht betrogen, nicht gefangen. Dabei schlief er ein.
Als er am nächsten Morgen erwachte, war er so guter Dinge, so voll Hoffnung, dass er sich vornahm, die Hütte bis ins Kleinste zu untersuchen, ob nicht doch irgendwo der Becher für den Alten verborgen sei. Und so begann er, jedes einzelne Brett abzuklopfen, um einen Hohlraum zu finden. Auch den Boden tastete er ab, aber er fand nichts, absolut nichts. Immer wieder versuchte er es; schließlich gab er auf und setzte sich hin. Vor Langeweile brach er sich ein Stückchen von dem Ton ab und spielte damit. Er drehte Kügelchen und fing auch bald an, Autos, Häuser oder was ihm gerade einfiel aus dem Ton zu formen. Er stellte all seine Werke auf die Balken, an die von außen die Bretter der Hütte festgenagelt waren. Viele, viele einzelne Teilchen hatte er schon gefertigt. Sie gefielen ihm, wenn er sie betrachtete.
Plötzlich kam ihm die Idee, dass er vielleicht ganz richtig war hier in der Hütte, dass er den Becher erst formen, erst modellieren sollte, um ihn dann dem Alten zu bringen. Wie ein Blitzstrahl hatte ihn dieser Gedanke durchbohrt, und sogleich fing er an, einen Becher mit seinen Händen zu modellieren. Und schon nach kurzem war er fertig. Er betrachtete ihn: Er war plump. Er stellte ihn auf die Seite und begann, einen neuen herzustellen. Er sollte schöner sein! Er wollte sich nicht schämen für die Plumpheit und die Ungeschicklichkeit, die da beim Modellieren ans Tageslicht kam. Der zweite Becher war tatsächlich ein bisschen schöner, aber es fiel ihm ein, dass er dieses und jenes noch machen könnte, den Ton ein bisschen dünner, den Becher ein bisschen höher, den Griff ein bisschen eleganter. So gestaltete er Becher für Becher, doch immer, wenn er mit einem fertig war, entdeckte er noch etwas, das er noch schöner machen konnte. Und so modellierte er eine lange, lange Zeit. Es standen bald alle Balken rundum in der Hütte voll mit den getrockneten Tonbechern. Alle waren ihm nicht schön genug, trotzdem aber hatte er Freude beim Modellieren gehabt.
Er brach sich gerade wieder ein Stück vom großen Tonklumpen ab und wollte zu modellieren beginnen, als sich eine unheimlich große Stille ausbreitete. Es wurde so still, dass nichts, was er je gehört hatte, was er kannte, an diese Stille heranreichte. Es wurde auch heller, aber nicht so, wie die Sonne bei Mittag scheint; es war eine andere Helligkeit. Es schien alles durchsichtig zu sein, trotzdem aber konnte man alles auch so erkennen, wie es normal war. Alles war hell, alles glänzte aus sich, leuchtete aus sich selbst. Er verstand das nicht. Als er sich umschaute, sah er an der Tür eine leuchtende Gestalt stehen. Ein junger Mann blickte ihn mit strahlenden Augen an. Er sagte nichts, er rührte sich auch nicht, er stand nur da. Er wusste, er hatte diesen Blick, er hatte diesen Mann schon einmal gesehen. Und nun fiel es ihm ein, wie aus einer weiten Vergangenheit: Das war sein Meister! Und es wurde ihm noch mehr Bewusst. Der, der hier stand und ihm zuschaute, der ihn anschaute, das war er selbst, Jesus Christus. Und er war ganz erschüttert vor Freude und es lief ihm ein Schauder den Rücken hinunter.
Er wusste nicht, wie lange er so dagestanden hatte, erstarrt in dieser Freude. Doch nun setzte er sich nieder und begann zu modellieren. Es ging wie von selbst. Seine Hände glitten über den Ton, und sie formten, sie kneteten, sie walkten, sie ritzten. Es war herrlich, sich selbst beim Arbeiten zuzuschauen. Es war die wunderbare Nähe des Meisters, die ihm die Kraft gab, ihm die Freude gab, die ihn führte, alles so herrlich zu machen. Schon nach kurzer Zeit war ein Becher fertig. Dieser ließ sich mit den anderen nicht vergleichen. Er war so schlicht und einfach und trotzdem so schön und so vollkommen, dass er ihn ununterbrochen anschauen musste. Den hatte er gemacht. Er konnte es fast nicht glauben, wenn er an seine früheren Versuche dachte, die auch schon gut waren. Aber das, was hier vor ihm stand, das übertraf alles bei weitem. Er wandte sich zur Tür, um zu schauen, ob sein Meister auch seinen Becher sehe. Doch in der Tür stand nicht mehr die leuchtende Gestalt, sondern der Alte von der Höhle im Walde. Der sagte zu ihm: „Na, bist Du endlich fertig? Ich habe schon gedacht, es wird gar nichts mehr. Jetzt muss ich einmal nach dir schauen.“ Der Alte wendete sich in der Hütte rundum und betrachtete all die Figuren, die der junge Mann geformt hatte. Auch die Gefäße, vom kleinsten bis zum größten und auch das auf dem Tisch stehende, das schönste von allen. Er sprach: „Gut, wir können gehen.“ Doch der Junge sagte: „Warte noch, ich will all diese misslungenen, hässlichen Stücke wegwerfen.“ Aber der Alte hielt ihn zurück: „Bitte, schau Dir jedes Teil noch einmal genau an, aber zerstöre keines! Es ist so wichtig, dass du dich später erinnerst, an jedes einzelne.“ Und so nahm sich der junge Mann viel Zeit, um wirklich jedes Teil noch einmal zu betrachten und es sich einzuprägen.
Danach nahm er den letzten, den schönsten aller Becher und ging mit dem Alten in den Wald zur Höhle. In der Höhle nahm der Alte den Becher an sich und fing sofort an, den jungen Mann einzuweisen in Gesetze, in Geheimnisse, in alles, was diese Erde hier betraf, und in noch viel, viel mehr. Der junge Mann hörte zu. Es wurde ihm nie zu viel, und er wusste, dass alles, was er hörte, stimmte, obwohl es manchmal märchenhaft klang.
Sieben Jahre dauerte es, bis ihm der Alte alles erzählt hatte. Und nach den sieben Jahren erzählte er ihm die letzte Geschichte. Sie handelte von einem jungen Mann, der Gott erfahren wollte und nun auf der Erde sei, um einen Becher zu holen. Den Becher brauche er, um aus einer Quelle zu trinken, die ihn Gott erkennen lässt. Am Ende stand der Alte auf, ging in die Ecke, holte den Becher aus Ton und sprach: „Ja, dieser Becher ist schön, aber er ist noch nicht gediegen, du brauchst einen gediegenen Becher, um aus dieser Quelle zu schöpfen.“ Der junge Mann schaute ihn wieder an und fragte: „Ja, wie mache ich denn diesen tönernen Becher gediegen?“ Der Alte erwiderte: „Das geht von ganz allein! Du musst nur in die Welt hinaus zu den Menschen. Ich werde dir dabei helfen.“ Er klopfte ihm mit seinen Fingern auf die Stirn.
In diesem Augenblick, als die Finger des Alten seine Stirn berührten, wurde die Welt wieder so gläsern wie damals in der Hütte. Alles strahlte aus sich, die Welt war gläsern, und trotzdem war sie es auch wieder nicht. Nur langsam gewöhnte er sich an diesen Zustand. Nach einer Woche konnte er recht gut damit umgehen. Es war herrlich in einer solch leuchtenden Welt! Bald schon verließ er den Alten und ging durch den großen Wald hinaus in die Welt zu den Menschen, von denen er damals gekommen war.
Die erste Person, die ihm begegnete, war ein altes Mütterchen, das auf dem Weg zur Kirche war. Auch sie leuchtete, doch nicht so stark wie die Blumen und die Tiere, aber sie leuchtete. Und als er sie genau betrachtete, sah er in ihrem Inneren einen Becher, einen schönen Becher. Der war es! Der strahlte und leuchtete und machte alles durchsichtig. Er schaute sich den Becher an und war der Meinung, dass er nicht ganz so schön sei wie der seine, doch schon wunderbar.
Sie gingen ein Stück nebeneinander, sie sprachen nicht miteinander, doch er hatte den Eindruck, dass das alte Mütterchen plötzlich weniger gebeugt ging. Auch ihre Schritte waren nicht mehr so schlürfend, sie waren leichter, gerader, fröhlicher. Er hatte den Eindruck, sie würde am liebsten springen und hüpfen wie ein Kind. Als sie in das Dorf kamen, ging sie in die Kirche, und er wanderte weiter durch das Dorf. Sie hatten nichts gesprochen, doch irgendetwas schien sie innerlich verbunden zu haben. Und so winkte er ihr im Geiste nach und wünschte ihr alles Gute.
Auf den Straßen des Dorfes waren viele Menschen unterwegs, und er war erstaunt, wie dunkel die meisten waren, wie wenig sie leuchteten. Doch dann auch wieder solche, die einen so herrlichen Glanz verbreiteten wie das alte Mütterchen. Er schaute sich alle Menschen ganz genau an. In jedem sah er innen ein Gefäß, manchmal plump, so wie seine ersten Versuche, manchmal waren es nur Kügelchen, Autos oder sonst irgendein Spielzeug. Bei manchen, das waren auch die dunkelsten, war nichts außer dem großen Klumpen Ton, der schwer im Innersten hing.
Er ging weiter durch das Dorf, kam bald am Rand des Dorfes zu den ersten Feldern und wanderte über diese dahin. Er fühlte sich wohl und glücklich. Als es Abend wurde, spürte er einen großen Hunger. Da begegnete ihm ein alter Bauer, der ganz traurig ausschaute. Er schaute in sein Innerstes und sah, dass das Gefäß, der Becher, der in ihm war, schön war. Sie gingen nebeneinander, und der Bauer begann zu erzählen, dass seine Frau und sein Kind zuhause krank seien, dass ihn das betrübte und traurig machte.
Während des Weges, den sie gemeinsam gingen, erzählte der Bauer sein ganzes Leid, seine ganzen Sorgen, seine Ängste, und unser junger Freund hörte zu und stellte auch hier fest, dass die gebeugte, traurige Haltung schon nach kurzer Zeit weg war. Ein weit ausholender Schritt war es nun, der sie vorwärts trug.
An einer Wegkreuzung sagte der Bauer: „Ich lade dich ein zum Essen und zum Schlafen. Es wird zwar ein spärliches Mahl sein, doch wir werden satt werden.“ Er ging mit. Nach einer kurzen Wegstrecke erreichten sie ein schlichtes Haus. Der junge Mann begrüßte die Tochter von vielleicht fünf Jahren und die Frau des Bauern, die beide krank waren. Das Essen war mehr als spärlich. Es gab für jeden eine Kartoffel und ein Glas Milch. Mehr gab es nicht.
Nach dem Essen gingen sie ins Bett. Der junge Mann sollte bei der Tochter im Zimmer schlafen. Er betrachtete das kranke Mädchen und stellte viele dunkle Bereiche fest. Er sah aber auch im Innern ein wunderschönes Gefäß, das leuchtete, doch das Licht konnte nicht, wie bei anderen Kindern, ungehindert ausstrahlen, sondern war eingekerkert in diese dunklen Bereiche. Wie er so darüber nachdachte, warum dies wohl so sei, spürte er einen starken Strom von sich selbst weggehen zu dem Mädchen hin. Dieser Strom bewirkte, dass das Licht beim Mädchen hell aufflackerte, kräftiger wurde und langsam alle dunklen Stellen aufzulösen begann. Er wunderte sich darüber und beobachtete weiter. Immer stärker spürte er den Strom von sich zu dem Mädchen. Wieso geschah dies? Als alles Dunkle um das Mädchen von dem Licht, das nun verstärkt aus ihr strahlte, aufgelöst war, graute auch schon der Morgen.
Der junge Mann fühlte sich nicht müde, sondern frisch und erholt. So stand er auf, ging mit dem Bauern aufs Feld und half ihm bei der Arbeit. Sie machte ihm Spaß, und sie hatten eine heitere Stimmung, obwohl sie nicht miteinander sprachen. Es schien ihm, dass sie so zusammen arbeiteten, wie Kinder sich gegenseitig einen Ball zuwerfen. Einer schob dem anderen die Arbeit zu und wieder zurück, und dabei kamen sie vorwärts über das ganze Feld. Gegen die Mittagszeit waren sie aufeinander schon so eingespielt, dass sie nun ihr Augenmerk darauf legten, dem anderen die Arbeit so geschickt zuzuspielen, dass dieser sie ohne Umstände ausführen konnte. Sie waren dabei so vertieft, dass ihnen gar nicht auffiel, wie schnell die Zeit vergangen war. Erst als die Sonne über den Hügeln unterging, hielten sie inne. Als sie auf ihr Tageswerk zurücksahen, meinte der Bauer, dass er alleine eine Woche gebraucht hätte, um das zu erledigen, was sie nun an einem Tag geschafft hatten. Voll Freude über diese gewaltige Arbeitsleistung traten sie den Heimweg an.
Als sie nur noch ein Stück nach Hause hatten, lief ihnen das Mädchen entgegen. Der Bauer konnte es nicht glauben. Seit einem halben Jahr konnte es nicht mehr aus dem Bett! Es war für ihn ein Wunder.
Das Essen war genauso bescheiden wie am Vortag. Danach gingen sie wieder schlafen. Der junge Mann dachte jedoch an die kranke Frau und an das Bild, das er in ihr gesehen hatte. Es war kein Gefäß vorhanden, sondern nur sinnloses Spielzeug. Und wie er so über sie und das Bild, das er gesehen hatte, nachdachte, fühlte er sich plötzlich in die Hütte zurückversetzt, in der er damals modelliert hatte. Er war jetzt nicht allein, sondern die Frau saß bei ihm. Er sah ihr zu, wie sie aus dem Ton die unsinnigsten und scheußlichsten Sachen modellierte.
Darauf holte der junge Mann einen seiner einfachsten Becher von dem Balken und stellte ihn vor sie auf den Tisch. Sie betrachtete ihn, nahm sich ein Stück Lehm und fing an, ebenfalls ein Gefäß zu formen. Es war einfach und plump wie seine ersten Versuche. Er schaute ihr weiter schweigend zu. Er wusste nicht, wann das Ganze geendet hatte. Auf jeden Fall wurde er beim Morgengrauen wach.
Voll Freude und Heiterkeit ging er mit dem Bauern aufs Feld. Heute hatten sie eine andere Arbeit auf einem anderen Feld zu verrichten. Es ging ihnen wie gestern. Bis Mittag lernten sie, sich aufeinander einzustellen, bis abends wurden sie dann immer perfekter im Umgang miteinander bei der Arbeit. Die Zeit verging ihnen schnell. Als sie schließlich wieder ihr Tageswerk betrachteten, hatten sie wieder so viel geleistet, wie der Bauer allein nur in einer ganzen Woche geschafft hätte.
Freudig gingen sie den Weg zurück. Heute kamen ihnen das Mädchen und die Bäuerin entgegen. Der Bauer wunderte sich sehr. Als sie abends beim Essen saßen, war das Essen reichlicher, denn das Mädchen war in den Wald gegangen und hatte Beeren gepflückt, und die Bäuerin hatte im Garten Gemüse geerntet. So konnten sie sich richtig satt essen. Wohlig schliefen sie ein.
Der junge Mann blieb noch ein paar Wochen bei ihnen. Die Tochter wurde völlig gesund, und der Frau ging es von Tag zu Tag besser. Auch machte ihnen die Arbeit, die sie verrichteten, so viel Spaß, dass die Zeit schnell verging; die Arbeit war keine Last mehr. Auf den Feldern wuchs alles wunderbar. Es schien, als würden die Kühe mehr Milch geben als vorher. Das alles konnte er verstehen. Am meisten wunderte ihn jedoch, dass er während der ganzen Zeit, die er bei ihnen war, kein einziges Wort zu sprechen brauchte, obwohl es oft Situationen gab, in denen sie ihn etwas fragten. Immer hörte er ihnen ganz aufmerksam zu. Er merkte, wie sie sich im Laufe des Gespräches selbst die Antworten gaben. Gelegentlich kamen auch aus den umliegenden Bauernhöfen Nachbarn vorbei, die von dem sonderbaren jungen Mann gehört hatten.
Es hieß, in seiner Nähe geschähen so merkwürdige und erfreuliche Dinge. Alle, die zu ihm kamen, machten diese Erfahrung. Sie fühlten sich nach einer gewissen Zeit erleichtert und erhoben, fanden Rat in ihren Problemen, fühlten sich gesünder und hatten wieder mehr Kraft, ihre Arbeit anzugehen. Sie konnten plötzlich Leute verstehen, die sie vorher nicht verstanden hatten. Sie hatten den innigen Wunsch zu verzeihen, wo sie vorher Bitterkeit nachtrugen, oder sie wurden einfach frömmer.
Die Kunde von seinem Wirken, das so wortlos geschah, breitete sich schnell in diesem Landstrich aus. Es eilten immer mehr Menschen hin zu diesem einsamen Bauernhof, um den jungen Mann zu sehen, um in dessen Nähe zu weilen.
Nach einiger Zeit machte er sich auf den Weg und wanderte weiter. Er spürte beim Weggehen, dass ihn ein liebevolles Band mit all den Menschen verband, die er hier kennengelernt hatte.
Bei seiner Wanderung kam er an einer Kapelle vorbei. Er ging hinein, um zu beten. Während des Betens erschien ihm der Alte aus dem Walde und zeigte ihm seinen Becher, der am Anfang tönern war und nun einen leichten metallischen Glanz bekommen hatte. Ja, er funkelte schon etwas. Der Alte aus dem Wald erklärte ihm, dass nun der erste Teil erfüllt sei. Jetzt müsste er in die Stadt gehen, um die Menschen zu belehren. Er brauche sich um nichts zu kümmern, alles sei schon vorbereitet.
So plötzlich, wie der Alte erschienen war, verschwand er wieder. Der junge Mann setzte also seine Wanderschaft fort und kam bald zu einer großen Stadt. Auf dem Marktplatz traf er eine große Menschenmenge an. Es wurde eine politische Rede gehalten, und er hörte den Redner fordern, dass man die Leute zwingen sollte, lesen und schreiben zu lernen, dass man sie zwingen sollte, gescheit zu werden, klug zu werden, dass sie dann erst fähig seien, glücklich zu sein.
Er hörte all das Gerede und wunderte sich. Der Redner fragte ihn, der ganz vorne stand, was er denn davon halte, was er denn meine. So ging der junge Mann zum Rednerpult und legte den Leuten seine Meinung dar:
„Es ist gar nicht so wichtig, dass man lesen und schreiben kann; wichtig ist, dass man die Freiheit hat, zu spielen und dabei zu lernen, und dass bei diesem freien Spiel der Alten und Jungen die Freude und die Liebe untereinander gepflegt werden. Ja, die Liebe soll man die Leute lehren, nicht so sehr das Schreiben.“ Er erzählte ihnen weiter, dass nur auf diese Weise die Menschen die Liebe lernten und dann von selbst weise würden, und dass diese Weisheit etwas viel Besseres und Größeres sei, als die Klugheit eines Gelehrten. Viele der Zuhörer fingen an zu brüllen und wollten ihn schon schlagen. So ging er weiter. Es folgten ihm jedoch drei, auf die seine Worte einen ganz besonderen Eindruck gemacht hatten. Am Stadtrand, an einem großen Baum, setzten sie sich nieder. Die drei baten ihn, noch genauer zu erzählen, wie er alles meine. Der junge Mann begann mit schlichten Worten und einfachen Bildern zu lehren.
So erzählte er ihnen ganz am Anfang die Geschichte von der Biene, die laut summend um die Blüte kreist, aber ruhig und still wird, wenn sie sich niederlässt, um vom Nektar zu trinken. Die Menschen seien genauso: Solang sie vom göttlichen Nektar, vom göttlichen Wissen getrennt sind, sind sie unruhig und müssen Lärm machen. Erst wenn sie sich mit der Meditation auseinandersetzten, würden sie ruhig und still. Alles Diskutieren, alles Ablenken hätte ein Ende, und sie begännen aufzunehmen, zu trinken von den göttlichen Weisheiten, die ohne Wenn und Aber, ohne Gegensätzlichkeit sind.
Er sah immer noch in jedem Menschen das Gefäß oder auch die Spielzeuge im Innern. Er erkannte, dass jeder Mensch irgendwann einmal anfängt, sich selbst zu modellieren, und dass es immer den gleichen Weg nimmt. Der Mensch beginnt, Spielzeuge zu bauen, um später zu entdecken, dass man auch ein Gefäß formen kann. In dem Augenblick, wo sie ein Gefäß formten, wurden diese Menschen fähig, etwas zu empfangen. So bildete sich in ihnen ein Becher, langsam oder schnell, je nachdem, wie fleißig einer an sich arbeitete und wie groß der Glauben und das Vertrauen in die unendliche Schöpferkraft Gottes war. Der junge Mann beobachtete auch, dass alle Menschen in seiner Gegenwart eine innerliche Veränderung erlebten. Es spielte dabei keine Rolle, ob sie Gegner oder Freunde waren, immer war ein Fortschritt zu beobachten. Einen Rückschritt gab es nicht. Wenn ein Mensch gestern noch Kügelchen drehte, formte er am nächsten Tag schon Käferchen oder irgendwelche anderen Dinge. Auf jeden Fall war ein Fortschritt zu sehen.
Manche seiner erbittertsten Feinde wollten ihm mit geschickt eingefädelten Diskussionen beweisen, dass er falsch lag mit seiner Ansicht. Er hörte ihnen aufmerksam zu. Oft geschah es, dass gerade diese Leute mit ihren Erklärungen genau seine Ansichten unterstützten. Sie erkannten auf einmal, dass sie vorher vollkommen falsch gedacht hatten. Er war nie einem Menschen böse, sah er doch immer sein Innerstes. Er wusste um jedes Gefühl, um jeden Gedanken Bescheid. Er selbst hatte vor langer Zeit die gleichen Gedanken.
Er blieb lange in der Stadt. Er gehörte mittlerweile so zu ihr wie eine Brücke oder eine Kirche. Die Zahl seiner Anhänger war groß. Es waren Hunderte. Auch die Zahl seiner Feinde, seiner erbittertsten Gegner war gewachsen. Sie waren es, die beschlossen, ihn zu vertreiben, aus der Stadt zu verbannen.
Eines Tages musste er sich ihrem Gericht stellen. Er gab ihnen auf all ihre Anschuldigungen keine Antwort, sondern ging gehorsam aus der Stadt.
Auf dem Weg zum großen Wald kam er wieder an der Kapelle vorbei; er ging hinein, um zu beten. Auch dieses Mal erschien ihm der Alte aus dem Walde. Er sagte ihm, dass er nun nichts mehr den Leuten zu erzählen brauche. Er solle in den Wald gehen, in seine Höhle, die schon seit einiger Zeit leer stehe. Da solle er einzelnen Schülern, die zu ihm geführt würden, all das vermitteln, was er damals erfahren hatte. Dann zeigte er ihm sein inneres Gefäß. Es war leuchtend und glänzend und von einer Herrlichkeit, wie er es sich in den kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können.
Der Alte erklärte ihm, dass die kommende Zeit im Wald den letzten Schliff für sein Gefäß, für seinen inneren Kelch bringe. Dann würde er die Reife besitzen, um aus der ewigen Quelle, die Gott erkennen lässt, zu schöpfen und zu trinken. Es löste sich das Bild auf, er verließ die Kapelle und ging in den Wald.
Er fand die Höhle verlassen, er meditierte viel. Seine Gedanken schweiften oft zu seinen liebevollen Freunden in der Stadt. Immer wenn er an sie dachte, sah er sie vor seinem geistigen Auge. Er sah ihre inneren Gefäße, und er sah ihr Verlangen, ihre sich ständig steigernde Sehnsucht. Das Sehnen seiner drei Freunde, die ihm gleich am ersten Tag mit zu dem Baum gefolgt waren. Ihr Sehnen war inzwischen so stark und brannte so fürchterlich in ihnen, dass sie sehr litten. Sie hatten noch nicht das Sehen wie er; deshalb taten sie sich schwer, allen Leuten liebevolles Verständnis entgegenzubringen. Sie wurden aufgerieben von ihrem Sehnen nach Gott und dem Unverständnis für die augenblickliche Situation.
So erschien ihnen eines Nachts im Traum der junge Mann und bat sie, zu ihm in den Wald zu kommen. Am nächsten Morgen unterhielten sich die drei und stellten fest, dass sie alle den gleichen Traum gehabt hatten. So machten sie sich auf den Weg, ihren lieben Freund im Wald zu suchen. Sie fanden den Weg schnell, und groß war die Wiedersehensfreude. Er lehrte sie eine gute Meditation, führte sie in tiefer Versunkenheit zurück in all ihre Leben. Sie hatten jedoch den Eindruck, als würden sie sich in einer Hütte befinden, in der ein Klumpen Ton lag, aus dem sie verschiedene Gegenstände formten.
Irgendwann begannen sie ein Gefäß zu modellieren, und mit der Zeit gelang es immer besser. Auch sie erlebten eines Tages die Anwesenheit des Meisters Jesus Christus und begannen, das letzte, das vollendete Gefäß zu formen.
So saßen sie nun vor ihm, alle drei. In jedem sah er das tönerne Gefäß, wunderschön und schlicht. Er wusste, auch sie müssen hinausziehen, um es gediegen zu machen. So begann er, sie all das zu lehren, was er selbst von dem Alten empfangen hatte. Es vergingen sieben Jahre, dann schickte er sie hinaus in die Welt. Ihre Ausstrahlung war in dieser Zeit so gewaltig geworden wie seine. In ihrer Nähe wurden die Leute gesund, es lösten sich Probleme, das Arbeiten machte Spaß.
Noch zwei Jahre wohnte der junge Mann in der Höhle, dann ging er in den tiefen Wald, setzte sich unter einen Baum und meditierte. Da wurde es hell und still, es kam sein Meister von damals und er sagte zu ihm: „Komm zu mir! Dein Becher ist nun vollendet.“ Der junge Mann stand auf, ließ seinen alten Körper am Baume zurück und ging mit seinem Meister zu dessen wunderschönem Haus. Er bewunderte wieder die Harmonie und die Ordnung im Garten.
Beim Betreten des Raumes hatte er wieder den Eindruck, in einem Tempel zu sein, doch er vermisste wie damals wieder einen Altar oder Opferstein. Der Meister gebot ihm, Platz zu nehmen. Dann holte er einen wunderbaren Kelch, stellte ihn vor dem jungen Mann nieder und sagte: „Das sind deine Werke! Jeder Edelstein, jede Perle, jedes Ornament sind gute Taten, gute Werke, die sich hier eingegraben haben.“
Nun ging der Meister, füllte den Kelch an der Quelle, brachte ihn zurück und reichte dem jungen Mann das Gefäß. Lange Zeit hielt der junge Mann inne, bis er das wunderbare Gefäß langsam an die Lippen setzte und trank. Er trank ihn aus bis zum Grunde und fühlte sich nun vollkommen eins. Er fühlte sich eins mit allem, was er wusste, was er sah.
Damals, als er die Menschen und ihre Gefäße sah, hatte er gewusst: Ja, ich war einmal an dieser gleichen Stelle. Jetzt war er ganz eins mit jedem einzelnen Menschen, fühlte dessen Regungen, Freuden und Ängste, Sorgen und Schmerzen. Er fühlte sich eins mit jedem Tier, mit jeder Pflanze, mit jedem Stein. Nichts, keine Regung war ihm unbekannt. Er war die ganze Erde, alles war er. So gewaltig, so umfassend war sein Einssein. Vom kleinsten Atom bis zum größten Gestirn.
Er fühlte den Weg der Planeten, er spürte das Leuchten und das Donnern der Sternenbewegungen. Jedes Stäubchen, das durchs All schwebte, alles war er. Nichts, absolut nichts war ihm verborgen. Es war in ihm, alles war hier. Er war überwältigt von dieser Schau, alles zu sein, alles zu erspüren, alles zu ergründen. Lange währte er im Sein. Er war sich Bewusst, dass er nun mit Gott verbunden war. Er wusste alles, er war alles.
Doch es fiel ihm ein, dass der Meister am Anfang gesagt hat: „Gott ist Alles und Gott ist Nichts“. Den ersten Teil, „Gott ist Alles“, verstand er nun. Er selbst war nun alles. Aber „Gott ist Nichts“? Er konnte es nicht ergründen. Deshalb fragte er den Meister: „Wie kann ich Gott dort begegnen, wo er Nichts ist?“ Der Meister sagte: „Du bist ihm schon einmal an der Stelle begegnet, wo er Nichts ist.“ Der junge Mann dachte lange nach, fand aber nicht die Lösung für diese Worte. So fragte er abermals: „Sag mir bitte: Wann bin ich Gott begegnet, wo er Nichts war?“
Der Meister zeigte ihm das Bild, als er mit dem Tonklumpen alleine in der Hütte war. Er sagte: „Dieser Tonklumpen ist Alles und doch Nichts“. Alles, was du daraus machst, das sind die Gefäße, Vasen, Autos. Immer wenn du aus dem NICHTS (Ton) etwas formst, gibst du Gott die Möglichkeit ins SEIN, in die Form zu treten. Gleichzeitig verliert Gott an dieser Stelle die Eigenschaft des NICHTS. Versuche nun, ihm im NICHTS zu begegnen. Versuche, dich von jeder Form, von jeder Vorstellung zu lösen und lasse dich umfangen vom Ungeschaffenen, vom Formlosen.“ Dem jungen Mann erschien das einfach. Sogleich begann er, sich etwas auszudenken, das noch nicht existierte. In dem Augenblick, wo er es sich ausdachte, war es da. Er erfand immer neue Möglichkeiten, neue Formen, neue Gestalten, neue Welten, neue Systeme, neue Planeten. Aber immer in dem Augenblick, wo er es ersonnen hatte, wo er schöpferisch gewesen war, war es existent. Er merkte, je näher er Gott im Sinne des NICHTS kommen wollte, um so ferner rückte er von ihm fort. Immer mehr Schöpfungen, die er dadurch erschuf, standen zwischen ihm und dem NICHTS.
Er wurde traurig darüber. Lange sann er nach und kam zu dem Schluss, dass er nicht durch Ergründung des Ungeschaffenen das NICHTS erkenne, sondern durch das Vergessen von allem zum NICHTS kommen müsste. So setzte er sich nieder und versuchte zu vergessen. Es gelang ihm nicht.
Er fing an, sich dafür eine Technik auszudenken; und so gebrauchte er seine schöpferische Kraft, um den größten, stärksten aller Winde zu erschaffen. Diesem ungeheuren Wind setzte er sich aus. Jahrtausende stand er im Toben und Brausen dieses Windes, in der Hoffnung, dass der Sturm alles aus seinem Bewusstsein wehen würde, was ihm Erinnerung brachte. Aber es half nichts.
Er ging weiter und schuf ein ungeheuer großes Feuer und ließ sich sogar verbrennen. Doch es half nichts. Die Erinnerung war nicht auszulöschen. Er war, er war und er war. Er versuchte es mit tosenden und reißenden Wasserfällen und Meeren, die ihn umspülten und überspülten, aber die Erinnerung blieb.
Als letztes begab er sich in die Mitte eines ungewöhnlichen Berges. Nichts, aber auch gar nichts, konnte von außen hineindringen. Auch das half nichts.
Er ging zu seinem Meister und erzählte ihm von all seinen Versuchen, Gott im NICHTS zu begegnen. Er klagte ihm das Leid, dass alles, was er im NICHTS ergründet, sofort in das SEIN der Schöpfung rückt und damit außerhalb des NICHTS ist. Er erzählte von seinen Versuchen zu vergessen und von den ständigen Fehlschlägen. Der Meister lachte, strahlte ihn aus glücklichen und zufriedenen Augen an und sagte: „Ach, was bist du doch für ein Dummerchen! Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, und sie sind ewig. Nichts, was Gott geschaffen hat, kann vergehen. Du weißt es doch! Wie konntest du es nur vergessen!“ Der junge Mann sagte zum Meister: „Hilf du mir bitte, dass ich Gott im NICHTS finde, sag mir, wie ich mich anstellen muss, um IHM da zu begegnen?“ Der Meister erwiderte: „Es ist nichts einfacher als das, du musst immer nur zwischen die Dinge schauen. Zwischen den Dingen erkennst du Gott im NICHTS.“
Mit großen Augen und weit geöffneten Ohren lauschte er, doch der Meister legte eine kleine Schweigepause ein, dann fuhr er fort: „Denke mal nach! Was hat dich immer am stärksten berührt? Doch nicht der Tag und auch nicht die Nacht, sondern der Übergang von einem zum anderen. Die Dämmerung ist es, die dich berührt hat. Oder was berührt dich noch? Das Leben oder der Tod? Beides nicht so sehr! Aber die Übergänge, die Geburt und das Sterben, das sind die Augenblicke, die dich berühren. Denke mal nach: Alles in der Schöpfung hat immer zwei Zustände. Dazwischen ist Gott im NICHTS. Wenn du den ganzen Tag wach bist, so ist es dir nicht ständig bewusst; wenn du schläfst, weißt du es auch nicht. Doch wenn du wach wirst, oder wenn du einschläfst, dann berührt dich etwas besonders. Ob es das Krankwerden oder das Gesundwerden ist, das Rauchen-Anfangen oder Aufhören, das Sich-Verlieben oder Getrennt-Werden. Immer diese Augenblicke sind es, die uns berühren, die anhaften. Versuche, dich auf die Zeiten dazwischen zu konzentrieren, versuche immer, dazwischen zu sein!“
Er übte sich, nicht das eine und nicht das andere zu sehen, sondern immer dazwischen durchzuschauen, doch er merkte, es war sehr schwer. Es war unheimlich schwer! Manchmal gelang es ihm besser, und manchmal gelang es ihm gar nicht. Als er einmal nahe dem Verzweifeln war, weil es ihm einfach nicht gelang, sein Bewusstsein dazwischen zuhalten, da kam sein Meister, Jesus Christus, nahm ihn ganz einfach bei der Hand und führte ihn mit, mit hinein in diese Lücke, mit hinein in dieses
DAZWISCHEN.
Und er ging mit.
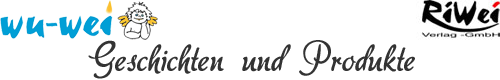
Diese Geschichte hat mich sehr berührt und es hat immer wieder durch meinen Körper gekribbelt. Sicher wird sie noch nachwirken.
Vielen Dank dafür